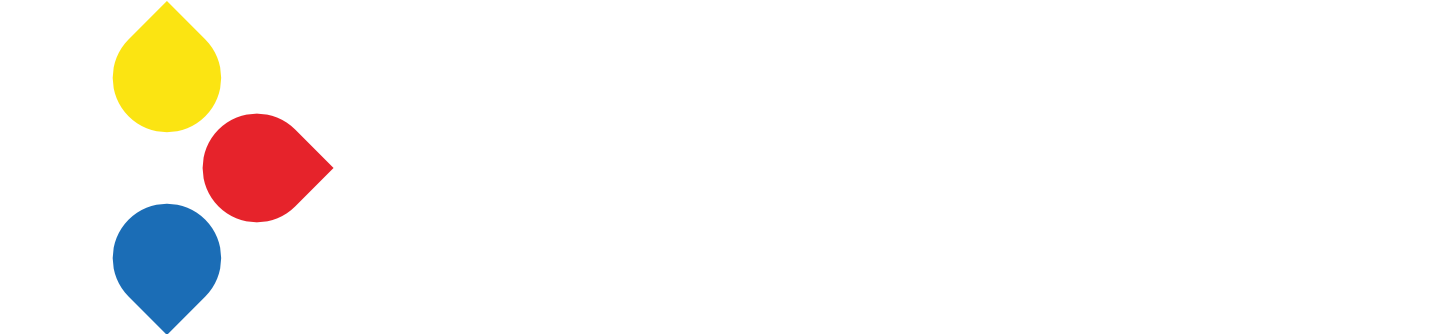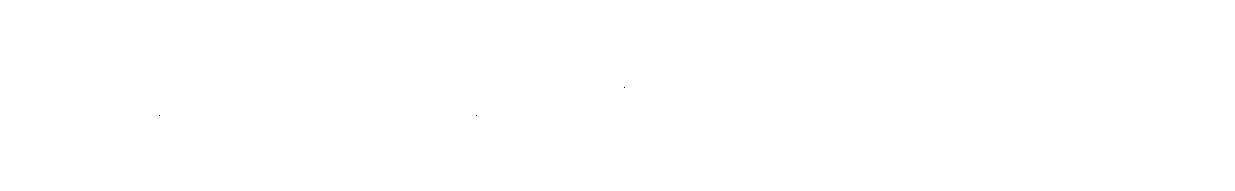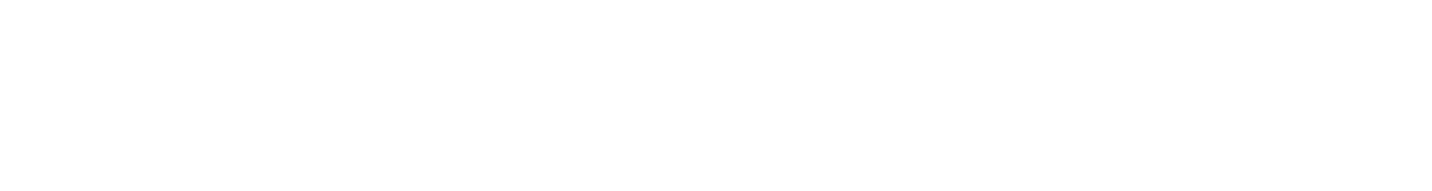Sonstige Mitteilungen | 04.11.2025
AOK Baden-Württemberg informiert
Seniorendienste Bad Wimpfen und AOK Heilbronn-Franken starten Partnerschaft zur Sturzprävention
Heilbronn. Die Seniorendienste Bad Wimpfen und die AOK Heilbronn-Franken haben eine Präventionspartnerschaft zur Sturzvermeidung in Pflegeeinrichtungen geschlossen. Ziel ist es, die Mobilität und Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern und Sturzfolgen wie Knochenbrüche zu vermeiden.
Pflegebedürftige Menschen haben ein deutlich erhöhtes Sturzrisiko. Mehr als jede zweite Person in einer Einrichtung stürzt mindestens einmal im Jahr. Um dem entgegenzuwirken, unterzeichneten Jens Reiner, Geschäftsführer der R + B Seniorendienste GmbH, und Katja Sigloch, Leiterin des AOK-KundenCenter Bad Rappenau, eine Vereinbarung über die enge Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren. Beide Partner möchten durch gezielte Maßnahmen die Zahl der Stürze und deren Folgen in Pflegeeinrichtungen reduzieren.
„Sturzprävention leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Selbstständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb hat die AOK Baden-Württemberg das Programm ‚SicherGehen – in stationären Pflegeeinrichtungen‘ entwickelt“, betont Katja Sigloch. „Mit ihrer Ausrichtung, die Gesundheitspotenziale der pflegebedürftigen Menschen zu fördern, sowie der regionalen Verantwortung, die sie für die Menschen übernimmt, ist die AOK Heilbronn-Franken“, so Jens Reiner, Geschäftsführer der R + B Seniorendienste GmbH, „ein idealer Partner für uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“.
Das Programm „SicherGehen – in stationären Pflegeeinrichtungen“ basiert auf dem Ulmer Modell und setzt an verschiedenen Punkten an, um Stürze zu vermeiden. Dazu gehören gezieltes Kraft- und Balancetraining zur Verbesserung der Mobilität und Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner, Schulungen und Qualifizierungen des Pflegepersonals nach aktuellen Standards sowie der Einsatz von Hüftprotektoren zur Vorbeugung von Oberschenkelhalsfrakturen. Eine strukturierte Sturzdokumentation ermöglicht zudem die Analyse des Sturzgeschehens und bildet die Grundlage für passgenaue Präventionsmaßnahmen.

Brustkrebs häufigste Krebserkrankung bei Frauen
Gesunder Lebensstil und Früherkennung senken das Risiko
Heilbronn. Brustkrebs ist und bleibt in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. 32 Prozent aller Neuerkrankungen entfallen auf das sogenannte Mammakarzinom. 2023 waren 4.719 AOK-Versicherte in Baden-Württemberg wegen Brustkrebs in Behandlung. 2019 bis 2023 ist ein jährlicher Rückgang von durchschnittlich 0,96 Prozent zu verzeichnen. Die AOK Heilbronn-Franken zählte 2023 175 Versicherte, die im Stadt- und Landkreis Heilbronn in Behandlung waren.
Weltweit rücken Prävention, Früherkennung und Forschung von Brustkrebs in den Fokus. Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, bei Männern jeder hundertste. In der westlichen Welt nimmt Brustkrebs als krebsbedingte Todesursache bei Frauen zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr die traurige Spitzenposition ein. Das mittlere Erkrankungsalter bei Brustkrebs liegt für Frauen bei 65 Jahren. Die Zahl der bei der AOK Heilbronn-Franken registrierten Erkrankungen nahm im Stadt- und Landkreis Heilbronn zwischen den Jahren 2021 und 2023 langsam, aber stetig ab: Von 205 auf 175 Fälle.
Die genaue Ursache von Brustkrebs ist oft unklar. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten jedoch einige Risiken nachweisen. Dazu gehören laut Dr. Ariane Chaudhuri, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg zu wenig Bewegung, der übermäßige Konsum von Alkohol, das Alter und eine familiäre Vorbelastung. „Das eigene Risiko verdoppelt sich, wenn Brustkrebs bei der Mutter oder Schwester auftritt“, so die Medizinerin. „Sind eine Großmutter oder Cousine betroffen, ist das eigene Risiko dagegen kaum erhöht.“ Wenn mehrere nahe Verwandte an Brustkrebs erkrankt sind, kann das laut der Ärztin ein Hinweis auf Genveränderungen sein. „Dann kann ein Gentest sinnvoll sein“.
Auch Hormone können beeinflussen, wie sich Brustkrebszellen vermehren. Eine Rolle kann spielen, in welchem Alter eine Frau ihre Periode bekommen, wann sie ihr erstes Kind geboren hat, wie oft sie schwanger war, ob sie die Antibabypille genommen hat oder Hormonpräparate.
Bei frühzeitiger Erkennung ist Brustkrebs meist gut heilbar, wobei das Risiko für Frauen durch gesunde Lebensweise sowie regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen reduziert werden kann. Es gibt einige Anzeichen, die auf einen Tumor oder einen gutartigen Knoten in der Brust hindeuten können. Wenn sich die Form oder Größe der Brust verändert, ein oder mehrere Knoten in Brust oder Achselhöhle tastbar sind, die Brustwarze oder ein anderer Teil der Brust sich nach innen zieht, die Haut der Brust sich rötet oder schuppt und nicht verheilt oder wenn eine Brustwarze klare oder blutige Flüssigkeit abgibt, sollte dies rasch von einer Ärztin oder einem Arzt abgeklärt werden, rät Dr. Chaudhuri.
Die AOK-Expertin erinnert zudem daran, dass alle gesetzlich versicherten Frauen ab 30 Jahren zur Früherkennung von Krebs einen Anspruch auf eine jährliche und kostenlose Tastuntersuchung der Brust haben. Alle Frauen zwischen 50 und 75 Jahren haben zudem alle zwei Jahre Anspruch auf eine Mammographie-Früherkennungsuntersuchung. Dabei wird die Brust aus zwei unterschiedlichen Richtungen geröntgt. Das Ergebnis wird in der Regel innerhalb von sieben Werktagen nach der Untersuchung zugesandt. „Nur für die Mammographie ist bisher nachgewiesen, dass sie das Risiko verringern kann, an Brustkrebs zu sterben“, erklärt die AOK-Ärztin.
Weitere Informationen unter: https://www.aok.de/pk/leistungen/krebsvorsorge-frueherkennung/brustkrebs/
Mit Prävention lässt sich Osteoporose verhindern oder mildern
Heilbronn. Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind in Deutschland 7,8 % der Frauen und 2,0 % der Männer zwischen 18 und 64 Jahren von Osteoporose betroffen, wobei die Häufigkeit mit dem Alter stark zunimmt. Insbesondere bei Personen über 65 Jahren sind fast ein Viertel der Frauen (24,0 %) und 5,6 % der Männer daran erkrankt. Von den AOK-Versicherten im Landkreis Heilbronn waren im Jahr 2023 insgesamt 3.571 Frauen (5 Prozent aller Versicherten) und 563 Männer (0,84 Prozent) wegen Osteoporose in Behandlung. Im Stadtkreis Heilbronn waren es 1.270 Frauen (3,88 Prozent) und 181 Männer (0,56 Prozent). Bei den Frauen ab 65 Jahren lag die Behandlungsquote im Landkreis Heilbronn bei 19,01 Prozent und im Stadtkreis Heilbronn bei 16,52 Prozent.
„Osteoporose ist kein unausweichliches Schicksal des Alters, sondern kann durch gezielte Vorsorge gemildert werden“, sagt Petra-Simone Dierich, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg, anlässlich des regionalen Gesundheitsatlas Osteoporose, den die AOK Baden-Württemberg im Vorfeld des Welt-Osteoporose-Tages (20. Oktober) veröffentlicht hat.
Die aktuellen Daten des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zeigen: 260.000 Menschen in Baden-Württemberg leiden an der Knochenerkrankung, wobei sich deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie zwischen den Geschlechtern abzeichnen. Während der Main-Tauber-Kreis mit 4,8 Prozent die höchste Prävalenz aufweist, verzeichnet Freiburg im Breisgau mit 3,0 Prozent die niedrigste Rate. Im Landkreis Heilbronn waren 3,82 Prozent aller Einwohner betroffen und im Stadtkreis Heilbronn 3,54 Prozent.
In Baden-Württemberg ist die Osteoporose-Häufigkeit in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Während im Jahr 2017 noch 4,2 Prozent der Bevölkerung ab 35 Jahren betroffen waren, lag die Prävalenz 2023 bei 3,7 Prozent. Dieser positive Trend spiegelt sich auch im bundesweiten Vergleich wider, wo die Werte im gleichen Zeitraum von 4,6 auf 4,0 Prozent zurückgingen. „Der Rückgang könnte auf verbesserte Präventionsangebote und ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein hindeuten – etwa durch mehr Bewegung im Alltag, rauchfreie Lebensweise und calciumreiche Ernährung“, erklärt Dierich.
Besonders deutlich zeigt sich die Verbesserung in urbanen Räumen: In Stuttgart sank die Erkrankungsrate seit 2017 um 0,6 Prozentpunkte, in Freiburg im Breisgau sogar um 0,9 Prozentpunkte. Dennoch bleiben Herausforderungen: In ländlichen Regionen stagnieren die Zahlen auf hohem Niveau, was unterstreicht, dass zielgruppenspezifische Aufklärung weiterhin notwendig ist. Auffällig ist der Zusammenhang mit dem Rauchverhalten: Regionen mit hohem Raucheranteil wie der Hohenlohekreis (4,7 Prozent) weisen bis zu 1,5-mal höhere Erkrankungsraten auf als Städte mit niedrigeren Raucherquoten.
Es gibt verschiedene Faktoren, die Osteoporose und dadurch ausgelöste Knochenbrüche begünstigen. Manche davon lassen sich beeinflussen, andere nicht. Die wichtigsten Risikofaktoren sind: Hohes Lebensalter, niedriges Körpergewicht, Bewegungsmangel, Unterversorgung mit Vitamin D und Kalzium, Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum. Gegen Osteoporose und deren Folgen lässt sich einiges vorbeugend tun – ein Leben lang. Wichtige Punkte: Sich regelmäßig bewegen, kalzium- und eiweißreich ernähren, Vitamin D tanken, nicht rauchen und keinen Alkohol trinken.
Die Daten des regionalen Gesundheitsatlas Osteoporose basieren auf der Hochrechnung der AOK-Versichertendaten durch das WIdO in Kooperation mit der Universität Trier. Link zum vollständigen Bericht: www.gesundheitsatlas-deutschland.de
Bleierne Müdigkeit erschwert den Alltag
Long COVID Betroffene haben vielfältige Beschwerden / Bisher keine umfassende Therapie möglich
Heilbronn. Extreme Erschöpfung, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, sowie anhaltende Atem- und Muskelbeschwerden: Long COVID hat zahlreiche Symptome und viele Menschen in der Region sind betroffen. 2023 wurden bei den AOK-Versicherten in Baden-Württemberg 14.272 Long COVID Erkrankungen diagnostiziert. Im Landkreis Heilbronn waren es 271 und im Stadtkreis Heilbronn 57.
„Long COVID" bezeichnet längerfristige, gesundheitliche Beeinträchtigungen im Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion, die über die akute Krankheitsphase von vier Wochen hinaus vorliegen. Die Beschwerden beginnen entweder bereits in der akuten Erkrankungsphase und bleiben längerfristig bestehen, oder treten im Verlauf von Wochen und Monaten nach der Infektion neu oder wiederkehrend auf. Dr. Alexandra Isaksson, Fachärztin für Psychiatrie und Physiotherapie bei der AOK Baden-Württemberg: „Eine Auswahl möglicher Symptome von Long COVID sind Schwäche und schnelle Erschöpfung, eingeschränkte Belastbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme (sog. „brain fog“) und anhaltende Atem- sowie Muskelbeschwerden. Die Beschwerden können einzeln oder auch in Kombination vorkommen.“ Teilweise sind die Auswirkungen so gravierend, dass die Patienten arbeitsunfähig sind.
Langzeitfolgen kann jede Person entwickeln, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Man kann Long COVID auch dann bekommen, wenn COVID-19 mild verlaufen ist oder man nach der Ansteckung keine Krankheitsanzeichen hatte. Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf und vielen Beschwerden während der Erkrankung an COVID-19 leiden aber vermutlich häufiger an Langzeitfolgen.
Letztendlich ist nicht geklärt, warum manche Patienten unter Long COVID leiden und andere nicht. Vermutlich tragen mehrere Prozesse zu Entstehung bei und wirken zusammen. Als Einflussfaktoren gelten unter anderem direkte Gewebeschäden durch das Virus, Entzündungs- und Autoimmunreaktionen, zu schwache oder zu starke Abwehr des Virus durch das körpereigene Immunsystem, körperliche und psychische Belastungsreaktionen, Gerinnungsstörungen und viele andere.
Fest steht: SARS-CoV-2 kann viele Organe befallen und schädigen und wird deshalb auch als Multiorganerkrankung angesehen. Außer der Lunge beispielsweise auch das Herz, die Nieren, das Gehirn, die Bauchspeicheldrüse, die Leber sowie das Nerven- und Gefäßsystem. Bestandteile des Virus sind bei einem Teil der Patienten und Patientinnen noch Monate nach der Infektion im Körper nachweisbar.
Personen mit Long COVID berichten über sehr unterschiedliche körperliche und psychische Symptome. Diese können sowohl einzeln als auch in Kombination auftreten und von sehr unterschiedlicher Dauer sein. Bislang lässt sich daher kein einheitliches Krankheitsbild abgrenzen. Wer Beschwerden hat, die mit einer vorausgegangenen SARS-CoV-2-Infektion zusammenhängen könnten, sollte sich zunächst an seinen Hausarzt wenden. Dieser wird eine Untersuchung durchführen und Blut abnehmen, um eine früher durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion nachzuweisen. Von den Ergebnissen der Laboruntersuchungen hängt das weitere Vorgehen ab. Bei Bedarf werden die Patienten an einen Spezialisten überwiesen. Je nach Art der Beschwerden zum Beispiel an einem Lungenarzt, einen Herzmediziner, einen Neurologen, einen Psychologen, einen Magen-Darmspezialisten oder einen Hals-Nasen-Ohrenarzt.
Es gibt keine spezifische Behandlung für Long COVID. Die Therapie ist immer individuell und orientiert sich an den jeweiligen Symptomen. „Eine spezifische medikamentöse Therapie existiert aktuell leider noch nicht, sodass die Betroffenen symptomatisch behandelt werden und in ihrer Alltagsfähigkeit unterstützt werden“, so Dr. Alexandra Isaksson.
- Zusätzliche Informationen zu der Erkrankung bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.longcovid-info.de

Weitere Artikel:
- Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
- AOK Baden-Württemberg informiert
- Verbraucherzentrale Baden-Württemberg informiert